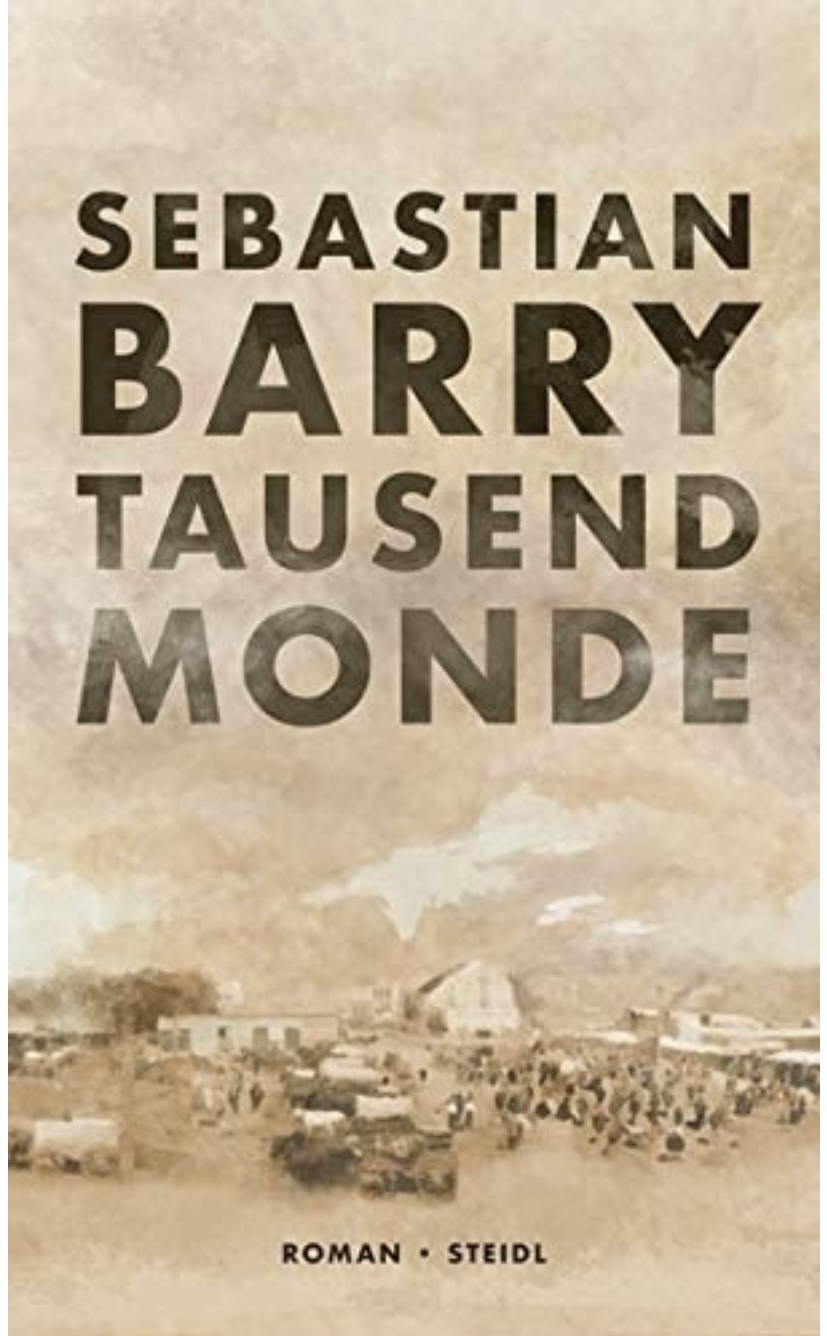
Mit Beginn der Lektüre begeben wir uns in die 1870-er Jahre nach Tennessee, einem Bundesstaat im Süden der USA. Der amerikanische Bürgerkrieg ist schon seit einigen Jahren vorbei, aber die Nachwehen sind noch zu spüren. Die Konföderierten haben den Krieg zwar verloren, doch Plünderer, Vagabunden, düstere Gestalten, raue Unionssoldaten und besiegte Grauröcke lungern herum und rebellieren gegen die neuen Verhältnisse in den Südstaaten, mit denen sie sich nicht anfreunden wollen. „Die geschlagenen Rebellen standen auf, standen überall wieder auf.“ (S. 36)
Soviel zum Setting. Und jetzt zum Inhalt:
Die junge Indianerin Winona erzählt uns rückblickend ihre Geschichte. Ihre Familie, Angehörige des Stammes der Lakota, wurde getötet, als sie ca. sechs Jahre alt war. Sie selbst wuchs anschließend als Waisenkind bei den homosexuellen Unionssoldaten Thomas McNulty, einem Iren und John Cole, einem Farmer mit indianischen Vorfahren, auf einer Farm in Tennessee auf. Thomas und John arbeiteten, genauso wie Rosalee, die stämmige schwarze Haushälterin und deren Bruder Tennyson, beide ehemalige Sklaven, auf Lige Magans Farm, die genau so viel abwarf, dass die ungewöhnliche kleine Wohngemeinschaft gerade so über die Runden kam. Ungewöhnlich? Ja, denn diese sechs Menschen, Thomas, John, Rosalee, Tennyson, Winona und der Farmbetreiber Lige, waren eine zusammengewürfelte Randgruppe, die der erzkonservativen Bevölkerung von Tennessee ein Dorn im Auge war: Zwei Homosexuelle, einer davon mit indianischen Wurzeln, eine Indianerin, zwei Ex-Sklaven und ein Farmer, der diese Leute bei sich arbeiten und wohnen ließ. Ungewöhnlich aber auch, weil diese Menschen ein bewunderns- und nachahmenswertes Vorbild für Solidarität, Loyalität, Freundschaft, Liebe und Toleranz darstellten.
Winona lernte Englisch, um im nahegelegenen Städtchen Paris, Tennessee nicht verprügelt zu werden, denn „eine Indianerin zu schlagen war kein Verbrechen, ganz und gar nicht.“ (S. 11). Natürlich war das nicht der einzige Grund, weshalb das Mädchen diese Sprache erlernte ;-). Aber es war tatsächlich so, dass die englische Sprache in gewisser Weise ein Schutzschild war.
Die Diskriminierung der Indianer und die latente Gefahr, der sie ausgesetzt waren, war eine unumstößliche Tatsache und auch Ex-Sklaven hatten keine Rechte und fielen Ungerechtigkeiten, Willkür und Abwertungen zum Opfer.
Winona trägt eine Zerrissenheit in sich, die sie intuitiv gelöst hat. Es geht dabei um die Vereinbarkeit der Liebe zu ihrer getöteten Ursprungsfamilie und zu ihren fürsorglichen Ziehvätern, die als Soldaten möglicherweise an deren Ermordung beteiligt waren.
Das Mädchen erinnerte sich oft an ihre liebevolle und mutige Mutter, die an den Winterabenden im Tipi Geschichten erzählte und an ihre Schwester, mit der sie draußen in der Prärie unter dem Sternenzelt spielte bevor das Unglück, geschah. „Die erwachsenen Frauen hielten das Lager in Ordnung, die Männer jagten und kämpften und unsere kleine Aufgabe als Kinder war es, herumzuspringen und glücklich zu sein.“ (S. 36) …und dann kamen Krieg, Gemetzel und Tod.
Gleichzeitig fühlte sie sich zärtlich verbunden mit ihren zuverlässigen und auf ihre Art liebevollen „Adoptivvätern“ Thomas und John, die ihr Halt gaben und Orientierung boten. „John, der Kiel meines Bootes, Thomas die Ruder und die Segel.“ (S. 201)
Dieses daraus resultierende innere Dilemma, das sie, wie gesagt, gut gelöst hat, beschreibt Winona eindrücklich: „Sie haben mir die Wunde zugefügt und sie geheilt, was eine unumstößliche Tatsache ist.“ (S. 13)
Winona lernte nicht nur Englisch, wie oben erwähnt, sondern auch schreiben und rechnen und als sie alt genug war, bekam sie eine Anstellung beim ca. 60-jährigen freundlichen und gerechten Anwalt Briscoe, der sein Büro im ca. sieben Kilometer entfernten Paris, Tennessee, hatte und der ihre Begeisterung für Bücher weckte.
Eines Tages lernte die inzwischen ca. 17-jährige Winona den um zwei Jahre älteren Jas Jonski, einen Weißen polnischer Abstammung, kennen. Er war Verkäufer in einem Geschäft für Trockenwaren, in dem sie regelmäßig einkaufte. Sie verliebten sich ineinander, er wollte sie heiraten, aber John Cole „wurde wütend wie ein Wels. „Kommt nicht in Frage, Madam!“ sagte er.“ (S. 18). Auch Mr. Hicks, der Chef von Jas und seine Mutter, sind alles andere als begeistert davon, dass Jas jemanden heiraten möchte „der einem Affen näher steht als einem Menschen“. (S. 20)
Eines Tages passierte es dann doch. Trotz der Englischkenntnisse. „Die Rothaut“ Winona wurde in der Stadt verprügelt und übel zugerichtet.
Thomas und John forderten ausgleichende Gerechtigkeit, „weil das einzige von Wert, was sie besaßen, versehrt worden war.“ (S. 22). Aber es war ja „ohnehin kein Verbrechen, eine Indianerin zu schlagen“. (S. 22)
Ihre Vermutung bzgl. Täter behielt Winona für sich, damit John Cole nicht auf die Idee kam, sie zu rächen, wofür er gehängt worden wäre. Winona, von den meisten Stadtbewohnern als Wilde betrachtet, die einer Wölfin ähnlicher ist, als eine Frau, beschloß, „die Sache selber in die Hand zu nehmen.“ (S. 25)
…und dann wurde auch noch Tennyson, der ehemalige Sklave, brutal zusammengeschlagen…
Es ist schmerzhaft und fast unerträglich, zu lesen, dass Winona, die von ihren „Adoptivvätern“ aufrichtig geliebt und fast wie eine Prinzessin betrachtet und behandelt wurde, so viel Abwertung und Missgunst von vielen Anderen ausgesetzt war.
„Ich war geringer als die Geringsten unter ihnen. Ich war geringer als die Huren im Hurenhaus…Ich war geringer als die schwarzen Fliegen, die einen im Sommer verfolgten. Geringer als die alte Scheiße, die hinter die Häuser geschüttet wurde.“(S. 26). Erschüttert und sprachlos liest man Sätze wie „Eine Indianerin ist keine Bürgerin, und das Gesetz findet nicht in gleicher Weise Anwendung.“ (S. 49) und Aussagen wie „Es war kein Verbrechen, einen Indianer zu töten, weil ein Indianer nichts besonderes war.“ (S. 57), jagen einem einen kalten Schauer über den Rücken.
Die traumatisierte jugendliche Ich-Erzählerin Winona beschreibt die raue Welt, in der sie aufgewachsen ist und lebt, mal poetisch zart, mal hart und direkt. Bisweilen spricht Sie ihre Leserschaft direkt an und bezieht sie mit ein. Sie erzählt nüchtern, leichtfüßig, ungeschönt und ohne jegliche Sentimentalität. Nur so ist es ihr, wie nach traumatischen Erlebnissen üblich, überhaupt möglich, über ihre erschütternde und traurige Geschichte zu sprechen. Die gefühlskarge Darstellung verstärkt dabei die emotionale Reaktion im Leser.
Der Autor schreibt seinen Roman in einer wunderschönen bildgewaltigen Sprache mit wortgewandten Formulierungen und anschaulichen Metaphern, die immer wieder zum Innehalten und nochmaligen Lesen Anlass geben.
Einige Beispiele möchte ich gern zitieren:
„In seinem Haus war ein Büro, das ganz mit schimmerndem Holz ausgelegt war, so dass man meinen konnte, es stehe Wasser auf dem Boden, so sehr schien er zu schwappen und zu zittern.“ (S. 27)
„Wenn Hochwasser eine Farm überschwemmt, stürzen zahlreiche Bäume um, und die Pflanzen, sofern sie bereits hoch stehen, werden niedergedrückt. Die ärgste Überschwemmung wird noch das letzte Feld verheeren; es muss von neuem gepflügt und von neuem geegt werden, und vielleicht ist es schon zu spät um in dem betreffenden Jahr noch eine weitere Aussaat vorzunehmen. Hat man nach der Überschwemmung erst einmal seine Kleidung getrocknet, merkt man womöglich, dass man im kommenden Jahr nicht so viel zu essen haben wird wie in diesem. Aber es ist klar wie der Tag, dass man der Stärke der Flut, des Tornados oder des heftigen Sturms mit ebenso großer Stärke begegnen muss. Um aufzubauen, was zerstört wurde, um das, was aus seiner Verankerung gerissen und von seinem Haken getrennt wurde, wieder an seinen Platz zu tun.“ (S. 52)
„Die Traurigkeit eines anderen Menschen kann die eigene ein wenig lindern. Habe ich festgestellt. Doch so seltsam ist das gar nicht, denn die Welt ist ohnehin mysteriös.“ (S. 56)
„Als ich diesen Gedanken zum ersten Mal fasste, kam er mir verrückt und verwegen vor, doch viele solcher Gedanken wirken weniger verrückt und verwegen, wenn man sie öfter denkt.“ (S. 133)
„Er ist so geradlinig wie die Lotschnur eines Maurers.“ (S. 208)
Der 1955 geborene, irischer Autor Sebastian Barry, hat mit „Tausend Monde“ einen abenteuerlichen und höchst unterhaltsamen Roman geschrieben, der an Menschlichkeit, Nächstenliebe und Toleranz appelliert und in dem es auch um grundlegende Fragen, z. B. Vereinbarkeit von Hass und Liebe, Solidarität, Rache, Aushalten von Nichtwissen und Verwirrung sowie Identität geht. Wer bin ich? Winona? Ojinjintka? Indianerin, Schwarze, Weiße? Mann oder Frau? Homosexuell oder heterosexuell?
Der Roman ist ein Highlight.
Er sorgte für unterhaltsame, packende, gleichzeitig spannende und entspannende, sowie informative Lesestunden.
Die Lektüre war für mich Lesefreude und Lesegenuss pur!
5/5⭐️
🇺🇸